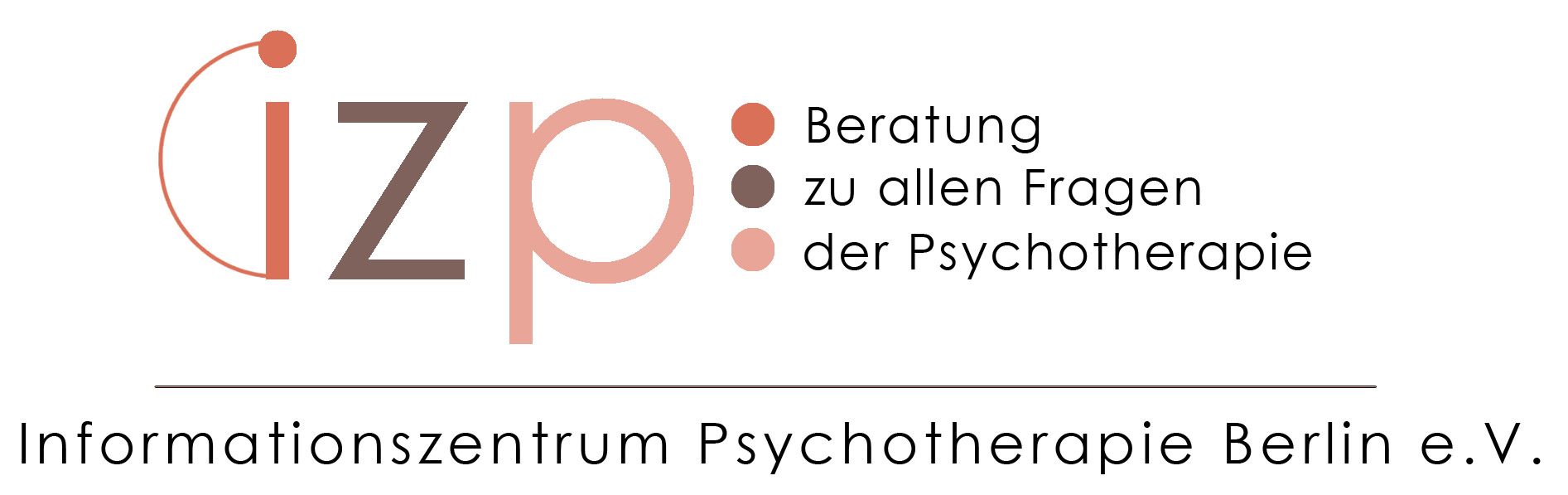Früherkennung in der Psychotherapie: Die Adoleszenz
In der Medizin gibt es den Ansatz einer Früherkennung von Krankheiten, seit die dafür notwendigen technologischen Möglichkeiten bereitgestellt worden waren. Denn es hat sich gezeigt, dass früh erkanntes Krankheitsgeschehen bessere Heilungschancen bietet. Deshalb werden Vorsorgeuntersuchungen angeboten für bestimmte Krankheiten, insbesondere Krebserkrankungen. Dieser Ansatz ließe sich aber sinnvollerweise von der Medizin auch auf die Psychotherapie übertragen, auf psychische Störungen. Allerdings ist ein solcher Anwendungsbereich von Psychotherapie noch wenig etabliert. Ein entsprechendes Vorsorgeangebot nicht ausreichend vorhanden. Ein weiteres Problem ist, dass die Betroffenen die Vorzeichen, die Symptome, oft nicht rechtzeitig und richtig lesen können. Sie missverstehen. Man ist ja noch nicht krank im herkömmlichen Sinne, man fühlt sich noch nicht „eigentlich“ krank. Man sagt sich z.B.: „Eigentlich ist alles in Ordnung. Bisschen „Blues“ vielleicht, hin und wieder, aber hat doch jeder mal, ist doch ganz normal. Da muss man nicht gleich zum Psychologen laufen!“ Und eben diese „Normalität“, die als Maßstab gilt für „In-Ordnung-Sein“, wiegt einen in Sicherheit. Bis…bis später (auch Jahre später) die Selbsttäuschung über die „Normalität“ als Referenzwert für Gesundheit auffliegt. Jetzt ist man „richtig“ krank geworden. Man leidet richtig und nicht mehr nur „normal“.
Sei es psychisch, sei es organisch. Man hätte es vielleicht vermeiden können, so krank zu werden, hatte aber die schleichende Gefahr unter der Tarnkappe der Normalität nicht rechtzeitig erkannt.
Nun können grundsätzlich in allen Lebensphasen (bis ins hohe Alter) aus allen möglichen Gründen psychische Störungen entstehen. Mit entsprechenden Anzeichen im Vorfeld womöglich. Allerdings gibt es bestimmte Lebensabschnitte, die für psychische Störungen und Störungsentwicklungen besonders anfällig sind. Solche, in denen insbesondere hormonelle Umbrüche eine erhöhte Sensibilität und Vulnerabilität mit sich bringen.
So z.B. die Adoleszenz, von der Pubertät bis ins junge Erwachsenenalter.
Entwicklungspsychologisch:
Mit Beginn der Pubertät hat der Jugendliche die Phase erreicht, in der er sich zunehmend abzugrenzen („abzunabeln“) versucht von den Eltern. Und deren Einfluss. Dieser Abgrenzungsversuch entspringt dem wachsenden Bedürfnis nach Emanzipation, nach größerer individueller Autonomie. Er will sich sozusagen selbst neu erfinden. Dabei muss er sich zwangsläufig an etwas Neuem orientieren. Und diese Orientierung findet er natürlicherweise in der Gruppe der Gleichaltrigen, der Peer-Gruppe. Hier werden neue Identitätskonzepte vorgeführt, weil alle Gleichaltrigen auch Gleichgesinnte sind, die sich in derselben Umbruchphase befinden.
So weit, so gut. Wäre da nicht dieses starke, dieses sehr starke Bedürfnis unbedingt zur Gruppe zu gehören, gehören zu müssen, beziehungsweise die Angst, nicht dazu zu gehören, nicht dazugehören zu dürfen.
Ein schon tief evolutionspsychologisch angelegtes Bedürfnis, weil Gruppenzugehörigkeit größere Sicherheit garantierte seinerzeit, in einer feindlichen früh und vorgeschichtlichen (Um-)Welt, als allein durch die Steppe zu laufen. Dieses unbedingte Zugehörigkeitsbedürfnis kann aber heutzutage in Konflikt geraten mit dem anderen Bedürfnis nach Selbstfindung und Autonomie. Weil es Anpassung erfordert. Verlangt. Sonst bist du raus.
Und Anpassung, wenn sie eigene Entwicklungsbestrebungen zu sehr unterdrückt, ist der ideale Nährboden für Krankheitsentwicklungen.
Die Krankheitsvorzeichen können Jugendliche meist gar nicht erkennen. Oder sie werden falsch interpretiert. Und wieder ist es die „Normalität“ und der fehlende Vergleichsmaßstab in der Gruppenblase, der eine adäquate Beurteilung der eigenen Situation, des eigenen Zustandes verklärt.
Verschärft hat sich diese Situation, diese Konfliktsituation des Erwachsenwerdens vor kurzem erst durch ein Phänomen mit dem täuschend freundlichen Namen Social Media. Die gute alte Freundesgruppe von fast familiären Zuschnitt hat sich völlig aufgelöst. Aufgelöst in eine globalen Peer-Gruppe. Vereint durch Social Media, die weltweit (fast) alle umschließt und durchdringt.
Ihr Sprachrohr das Handy.
Ihre Propheten die Influencer.
Sie geben Takt und Ton an. Sind das Maß der Dinge.
Die „Likes“ und Anzahl der „Followers“ bestimmen die Leitwährung.
So möchte man auch sein, selbst sein:
wie die Daumen-hoch-dekorierten Idolen.
Und das heißt Anpassung.
Anpassung, um dazu gehören zu können, wie eh und je.
Um nichts zu verpassen (FOMO, Fear of Missing Out).
Von Duckface zu Fishgape und wohin die Reise auch immer geht.
Fremdbestimmung auf Schritt und Tritt.
Und die Anpassung an die fremde Bestimmung fordert ihren Preis bei Jugendlichen.
Wenn sie es überhaupt bemerken, berichten sie über Selbstzweifel, über Selbstwertzweifel.
Weil sie dem Druck der geforderten Werte, der Leitwerte, kaum entsprechen können.
Und dieser Druck ist permanent.
Während die altehrwürdige Peer-Gruppe auch mal geschlafen hatte, sich ausgeruht und regeneriert hatte,
ist ihre globale Nachfolgerin, Social Media, rund um die Uhr auf Sendung,
24 Stunden am Tag, jeden Tag…
Social Media im Wachen, im Schlafen und im Träumen.
Man will den Anschluss nicht verlieren.
Die Zugehörigkeit zur Gruppe nicht verlieren.
Nichts verpassen.
Social Media als Droge, als Sucht.
Und die Abhängigkeit von der Droge:
wenn das Handy einmal verlegt wurde, das Gefühl, als sei kein Sauerstoff mehr im Raum…
Das IZP bietet Beratung zu Therapiemöglichkeiten, sich von dieser Abhängigkeit zu lösen. Damit es nicht erst zu Spätfolgen kommen kann, die dann wesentlich schwerer zu beheben wären. Zu diesen Folgen gehören, neben emotionalen und sozialen, auch, und nicht zuletzt, kognitive Beeinträchtigungen. Ein Buch zu lesen z.B. (also zu verstehen), kann für Jugendliche heute schon eine Herausforderung darstellen. Da übermäßige Handynutzung nachweislich führt zu verkürzter Aufmerksamkeitsfähigkeit (Konzentration), reduzierter Informationsverarbeitung, schwächerer Gedächtnisleistung. Und die Rede ist hier nicht etwa von einem Text wie „Sein und Zeit“ von Heidegger.
Neben der Sucht- bzw. Abhängigkeitsproblematik von Social Media und den kognitiven Beeinträchtigungen, die daraus folgen, gibt es natürlich auch noch den enormen Manipulationsfaktor von Social Media zu bedenken
für die eigene Selbstfindung in der Adoleszenz. Es könnte daher sinnvoll sein, den Spiegel der Normalität von Social Media, in dem man sich „täglich“ betrachtet, und der das eigene Selbstverständnis bestimmt und belästigt, für eine kurze Zeit einmal zu verhängen. Stattdessen in einen anderen Spiegel einen anderen Blick auf sich zu werfen, in dem die unter der Normalität versteckten feinen Brüche und Haarrisse, die latenten Unzufriedenheiten, Selbstwertverluste, Einsamkeiten sichtbar werden. Bevor die sich weiter entwickeln zu handfesten Problemen und ausgemachten psychischen oder organischen Störung. Früherkennung also.
Damit der Blick sich öffnen kann für die Fragen:
Wie geht es mir wirklich? Wer bin ich wirklich? Was will ich wirklich?
Vergessen werden aber soll nicht:
Neben dem globalen Einfluss von Social Media auf psychische Störungs- und Krankheitsentwicklungen, sind Jugendliche gleichzeitig selbstverständlich immer noch von all jenen möglichen Problemen betroffen, von denen sie auch schon vor dieser Social Media-Pandemie betroffen waren. Also seit eh und je. Probleme mit Eltern, Freundschaften, Schule, Liebe, Sexualität, Trennung, Kummer – eben mit dem Leben selbst.
Auch hier muss gelten:
Früherkennung hilft mögliche Spätfolgen zu vermeiden.
10781 Berlin
Telefon:
030 32 70 91 37
030 55 47 46 74
E-Mail:
kontakt@izp-berlin.de